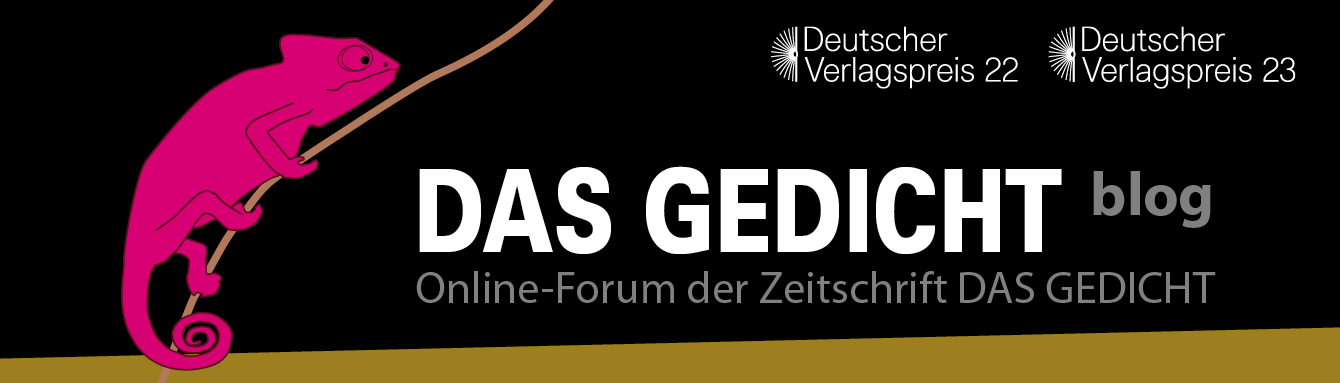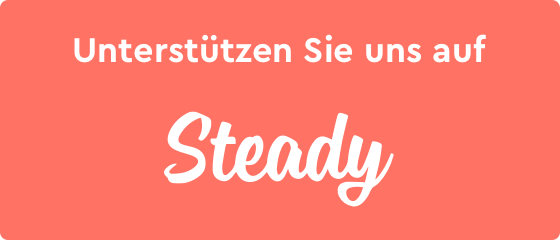»Gedichte mit Tradition – Neue Blätter am Stammbaum der Poesie«: eine fortlaufende Online-Anthologie, zusammengestellt von Jan-Eike Hornauer
Patricia Falkenburg
Manchmal.
Manchmal denkt es mich,
Kaum weiß ich
Woher.
Manchmal, im Verzagen,
Denkt es mich
Froh.
Manchmal, mitten im
Kleinen Glück, denkt es
Mich so traurig, so
Zuende.
Kaum weiß ich
Woher und wohin.
© Patricia Falkenburg, Pulheim
+ Zum Original
Zu diesem Gedicht inspiriert hat Patricia Falkenburg das (fast) titelgleiche Gedicht von Hilde Domin, das »Manchmal« heißt und sich lediglich dadurch in der Überschrift unterscheidet, dass es den Falkenburg-typischen End-Punkt hier nicht trägt.
In Hilde Domins »Manchmal« geht es um Geborgenheit und doch auch Ausgeliefertheit, um fremdbestimmten Schutz. Das lyrische Ich fühlt sich kindesgleich gut aufgehoben in seinem Sein nach einer, so steht stark zu vermuten, amourösen Angelegenheit, und auch wenn es gerade verlassen worden ist nach dem Liebesspiel, liegt es nun doch in der Nacht wohlig und zufrieden da. Ihm ist Sicherheit gegeben worden und Trost in dieser Welt. Dieses sehr prosanahe Gedicht besticht stark auch durch seine eindrückliche Bildsprache (da geht es um Geborgenheit durch eine beschützende Hand, ums Ins-Fell-Schmiegen und ein neugeborenes Tier) sowie seine formale Schlichtheit (keine Unterteilung in Strophen, keine komplexen Zeilenumbrüche, das Poem besteht aus nur einem und dazu recht einfach aufgebauten Satz). Der inhaltliche Akzent liegt auf dem Wohlfühlen.
Falkenburg nun abstrahiert im Inhalt, wird formal komplexer (u. a. gezielte Strophenform) und sprachlich herausfordernder (kunst-volle, sprach-sezierende, absichtsvoll sperrige Wendungen). Dazu übernimmt sie zwar das Wohlfühlen, das von außen kommt, als Option, gesellt ihm aber als Alterntivmöglichkeit auch gerade das Gegenteil, das Umwohl- und Bedrängtfühlen hinzu. Wo es bei Domin nur Trost gibt, kann hier auch die Trostlosigkeit, die Verzweiflung unwillkürliches Ziel der fremdgesteuerten geistig-emotionalen Reise sein. Zentral ist hier, anders als bei Domin, letztlich nicht das Tröstende (und auch nicht dessen Gegenteil), sondern das, was bei Domin nur Vorbedingung ist: das Ausgeliefertsein.
Es geht also um die In-die-Welt-Geworfenheit des Menschen, um seine Überforderung, um seine Fremdbestimmtheit und sein Sich-selbst-Ausgeliefertsein. Die Gefühlsfolgen sind zwar bedeutend und zweischneidig (existentielle Geborgenheit und Verlorenheit sind ja möglich), aber letztlich nicht der Mittelpunkt. Patricia Falkenburg weitet also das Themenfeld und nimmt eine Fokusverschiebung vor. Zu ihr gehört auch, dass bei Falkenburg nicht mehr zwischenmenschliche Interaktion alles antreibt, sondern ein unbestimmtes und un(an)greifbares Es, quasi eine höhere Macht oder Instanz (die freilich aber durchaus auch nur in der Hauptfigur selbst sein kann) das steuernde Element ist.
+ Zur Autorin
Patricia Falkenburg, geboren 1961 in Mannheim, wohnt seit 1999 mit ihrer Familie in Pulheim bei Köln. Promovierte Naturwissenschaftlerin (Molekularbiologin), Medical Writer, Lyrikerin. Seit 2015 Veröffentlichung von Gedichten in Deutsch und Englisch, mit und ohne Fotovisualisationen, und von Lyrik-Videos. Redakteurin bei »Lyrik in Köln«, Mitglied der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik, Leipzig, und des PEN Freundes- und Förderkreises. Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien, z. B. in Periodika wie »Poesiealbum neu«, »Versnetze« und »Dichtungsring« sowie in Sammelbänden wie »FriedenLieben« (hg. v. Reinhard Rakow, Geest-Verlag 2017) und »Gefangensein. Drinnen und Draußen« (Gedichtband, hg. v. Gisela Weinhändler, muc Verlag 2018). Zur diesjährigen Buchmesse in Leipzig erscheint Falkenburgs erster Einzeltitel: »Portugiesische Notizen« (mit Grafiken von Bettina Haller, Lyrikheft Nr. 24, Sonnenberg-Presse Chemnitz).
www.patricia-falkenburg.com
 »Gedichte mit Tradition« im Archiv
»Gedichte mit Tradition« im Archiv
Zu dieser Reihe: »Gedichte mit Tradition – Neue Blätter am Stammbaum der Poesie« ist eine Online-Sammlung zeitgenössischer Poeme, die zentral auf ein bedeutendes Werk referieren, ob nun ernsthaft oder humoristisch, sich verbeugend oder kritisch. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge der von Jan-Eike Hornauer herausgegebenen Open-End-Anthologie. Alle bereits geposteten Folgen finden Sie hier.
 »Gedichte mit Tradition« im Archiv
»Gedichte mit Tradition« im Archiv